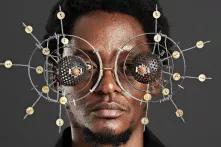Afrika ist eine geografische Realität, aber vor allem ein Konzept. Welche Rolle haben jeweils nationale Unabhängigkeitsbewegungen, panafrikanische Bestrebungen, internationale Einflüsse und neokoloniale Absichten im Rahmen der Abläufe gespielt, die zur Unabhängigkeit der Staaten Afrikas führten? Den Versuch, ein halbes Jahrhundert afrikanischer Staatlichkeit historisch einzuordnen unternimmt.
Obwohl afrikanische Regierungen erklärtermaßen für die Einheit des Kontinents eintreten, unterscheiden die meisten Experten und Nicht-Afrikaner nach wie vor zwischen einem „Afrika südlich der Sahara“ und „Nordafrika“ – speziell, wenn es um politische Fragen geht. Hier wird der Maghreb historisch wie kulturell der „arabischen“ Welt zugerechnet, die sich bis nach Asien hin erstreckt; und der Maghreb ist, wie Europa, Anrainer des Mittelmeers. Es ist vermutlich kein Zufall, dass die Grenzgebiete der beiden Unterregionen – die sich von Somalia und dem Sudan über den Tschad, das algerisch-malische Grenzgebiet bis hin zur Westsahara erstrecken – durchgehend wie anhaltend politisch labil sind. Gleichermaßen und trotz der Tendenz, regionale, von der Geografie bestimmte Untergruppen zu bilden, schweißt das Erbe der Kolonialzeit Gruppen von Ländern zusammen, die von den selben „Mutterländern“ beherrscht wurden und mit diesen nach wie vor auf vielerlei Art eng verbunden sind – und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Frankophonie mag zwar zunehmend nur noch für städtische Eliten von Bedeutung sein, ist aber eine kulturelle wie institutionelle Tatsache. Die ehemaligen britischen Kolonien gehören dem Commonwealth an. Wie anhaltend stark die Bindung an die Kolonialmächte von einst ist, zeigen auch die engen Beziehungen, die Ruanda und Kongo zu Belgien, die Angola und Mosambik zu Portugal haben. Oft ist der Austausch mit, sind die Kommunikationswege zum vormaligen Kolonialherren stärker ausgeprägt, als die zu anderen, selbst benachbarten, afrikanischen Staaten.
Eine Frage, die oft aufkommt, wenn man auf die jüngere Geschichte Afrikas zurückblickt, ist eine, die sich viele Bürger Afrikas sich selbst stellen: Was bedeutet „Unabhängigkeit“? Was hat sie den Menschen gebracht? Aus diesen legitimen, wenn auch einigermaßen gedächtnislosen Fragen (es bedarf schon einer kompletten Auslöschung historische Erinnerung um über die Grauen der Kolonialzeit, von Sklaverei, Zwangsarbeit, Enteignung, Gewalt, extremer Ausbeutung und Demütigung durch fremde Armeen und Siedler hinwegzusehen) ergeben sich drei weitere Fragen, mit denen wir uns in der Folge kurz auseinandersetzen wollen:
- Welche Rolle haben jeweils nationale Befreiungsbewegungen, internationale Einflüsse und neokoloniale Absichten im Rahmen der Abläufe gespielt, die zur Unabhängigkeit der Staaten Afrikas führten?
- Ist es möglich, nach einem halben Jahrhundert, ein Muster in den Befreiungskämpfen Afrikas auszumachen, ihre spezifischen wie gemeinsamen Züge zu erkennen und den Einfluss, den sie auf die politischen Entwicklungen nach der Unabhängigkeit hatten?
- Schließlich: Können wir versuchen einzuschätzen, was heute von den panafrikanischen Visionen und Träumen von Führern wie Nkrumah, Nyerere, Azikiwe und anderen geblieben ist?
Im Rückblick sollte versucht werden, die erste Frage auf eine Art zu beantworten, die sich so weit wie möglich jenseits ideologischer Positionen bewegt. Die beiden Positionen, die in der Regel die Diskussion beherrschen, sind einerseits die Absicht, die bestehenden Staaten dadurch zu legitimieren, dass man das nationalistische Erbe hochhält und andererseits eine scharfe Kritik an den herrschenden neokolonialen Verhältnissen, durch die die Unabhängigkeit der neuerdings zerfallenden Staaten jedes positiven Gehalts, jeder Massenbasis beraubt und ihnen häufig jede Art von Legitimität genommen wird. Die weit verbreitete Vorstellung, die Kolonialherren hätten die Unabhängigkeit nur deshalb gewährt, weil sich so das System rationaler und gewinnbringender gestalten ließ, ist eine grobe Vereinfachung eines komplexen Vorgangs. Ohne den anhaltenden Druck der Menschen selbst hätten die Kolonialmächte, die unter dem dreifachen Druck von Siedlern, Wirtschaftsinteressen und Militär standen, die Unabhängigkeit wohl kaum zugelassen. Frankreich hat jahrelang in Vietnam gekämpft um die Unabhängigkeit von Vietnam, Laos und Kambodscha abzuwenden – weniger als ein Jahrhundert nach der ausgesprochen grausamen und blutigen Eroberung. Gegen die Menschen Algeriens wurde ein völkermörderischer Krieg geführt, um Algerien in Frankreichs Macht zu halten. Auch wenn es in vielen afrikanischen Ländern keinen lang anhaltenden Krieg gab, gab es doch überall Kämpfe und Forderungen wurden mit Gewalt unterdrückt. Organisationen wurden verboten, Anführer verhaftet, Kundgebungen beschossen, Menschen getötet. Mancherorts entwickelten sich aus Kundgebungen Unruhen, beispielsweise 1949 in der Elfenbeinküste, oder gar Aufstände und Massenerhebungen wie 1947 in Madagaskar. (man schätzt, dass bei der Niederschlagung an die 90.000 Madagassen ums Leben kamen!).
Auf den ersten Blick könnte man dazu neigen, die Briten vom Vorwurf, Unabhängigkeitsbewegungen derart brutal unterdrückt zu haben, freizusprechen. Schon 1942 – und zweifellos unter dem Druck der Achsenmächte, die nicht davor zurückschreckten, die antikoloniale Stimmung in den britischen Besitzungen für ihre Zwecke auszunutzen – hatten sie ihre Absicht erklärt, sich schlussendlich aus allen Herrschaftsgebieten östlich des Suezkanals zurückziehen zu wollen. Wie bekannt, dauerte dieser Prozess recht lang, beispielsweise in Aden – Afrika wurde dabei jedoch überhaupt nicht erwähnt. In Westafrika passte die britische Philosophie und Praxis der „indirekten Herrschaft“ gut zu den Richtlinien, die der Völkerbund für die Verwaltung von Mandatsgebieten vorsah. Dennoch kam es, wenn auch selten, zu Zusammenstößen und Gewalt (in Nigeria und anderen Gebieten).
Dort, wo das gemäßigte Klima die Ansiedlung von Europäern zuließ – im Hochland Kenias, im Süden Rhodesiens und in Südafrika – fielen die Auseinandersetzungen jedoch nicht weniger brutal aus, als in den französischen Kolonien. In den beiden letztgenannten Ländern kamen europäische Siedler an die Macht und nahmen so Großbritannien die Möglichkeit, sich für die Dekolonisation zu entscheiden. Die Unabhängigkeit, die Eigenstaatlichkeit war das Ziel jener politischen Bewegungen und Parteien, die versuchten, die Massen zu mobilisieren (im Jargon der Polizei: „Unruhen unter den Eingeborenen“), um die Kolonialherrschaft zu stürzen.
Im französischen Kolonialreich kamen derartige Ziele nicht immer so deutlich zum Ausdruck, da eine zentrale Organisation, das Rassemblement Démocratique Africain (RDA), die lokalen Bewegungen koordinierte. Mit Ausnahme des Senegal, der seit dem 1. Weltkrieg einen Sonderstatus hatte (volle französische Staatsbürgerschaft für die vier Kommunen Dakar, Saint-Louis, Thiès and Rufisque), als Dank für die 200.000 Mann starke Senegalesische Infanterie, die im Krieg auf der Seite Frankreichs gegen Deutschland gekämpft hatte, arbeiteten sämtliche Parteien und politischen Bewegungen, die später die Führung der neuen Staaten bilden sollten, unter der gemeinsamen Führung der RDA. Deren wenig präziser Slogan hieß: „Befreiung der Massen Afrikas“. In Frankreich stand die RDA politisch der Kommunistischen Partei nahe, die sich gegen die Kolonialpolitik stellte, im wesentlichen jedoch verlangte, das Kolonialreich müsse demokratisiert werden damit einheimische Bevölkerungen ebenfalls in den Genuss der sozialen Errungenschaften der Volksfront kommen konnten. Das führte dazu, dass einige der wichtigsten Abschnitte des Befreiungskampfes, etwa 1948 der Streik der Arbeiter an der Eisenbahnlinie Dakar – Niger (über den der senegalesische Schriftsteller und Regisseur Sembène Ousmane einen großartigen Roman, „Gottes Holzstücke“ (1960, dt. 1988) geschrieben hat) nicht ausdrücklich im Namen der Unabhängigkeit geführt wurden, sondern für politische, soziale und wirtschaftliche Rechte, das heißt im Namen von Werten, die die Basis der französischen Republik bilden. Die Unabhängigkeit jedoch war das einzige mögliche Ergebnis. Der Kalte Krieg und die damit verbundene Möglichkeit zwischen den Machtblöcken zu lavieren, sowie, nach 1955, das Entstehen der Bewegung der Blockfreien im Gefolge der Afro-asiatischen Konferenz von Bandoeng zeigten klar in diese Richtung. Das Britische Empire verwandelte sich seit der Unabhängigkeit Indiens, 1948, nach und nach in einen Commonwealth formal unabhängiger Staaten (die Goldküste, die sich in Ghana umbenannte, erhielt 1954 Autonomie und wurde 1957 unabhängig). Frankreich, das noch bis 1962 ganz und gar mit dem Drama in Algerien beschäftigt war und sich noch kaum von dem Debakel in Indochina erholt hatte, konnte es sich offensichtlich nicht leisten, im Süden eine weitere Front zu eröffnen und musste sich entsprechend in eine Art der Dekolonisation ergeben, von der es nur hoffen konnte, sie ließe sich irgendwie kontrollieren und beherrschen. Die Methode hieß räumliche und politische Teilung. Die Franzosen hatten sich zwar aus Indochina zurückgezogen, Vietnam, das Land von dem es 1954 in Dien Bien Phu geschlagen worden war, aber durch einen Eisernen Vorhang geteilt zurückgelassen – ganz nach dem Modell Deutschlands und Koreas.
Die französische sozialistische Regierung erließ 1957 das „Loi-Cadre“, ein Gesetzeswerk, durch das die Zwangsarbeit abgeschafft und die bisher zwei geografischen Einheiten Französisch-Westafrika und Französisch-Äquatorialafrika in zahlreiche Territorien zerlegt wurden, aus denen in der Zukunft dann unabhängige Staaten entstehen sollten. Als 1958, vor dem Hintergrund des Putschversuches von Militärs, die die französischen Siedler in Algerien unterstützten, kehrte de Gaulle an die Macht zurück. Er beschleunigte die Dekolonisation indem er eine Volksabstimmung über nationale Selbstbestimmung in allen Teilen der „Union Française” (der neue Name, den man dem Kolonialreich gegeben hatte) durchführen ließ. Gewählt werden konnte zwischen der Unabhängigkeit für das jeweilige Gebiet und der Zugehörigkeit zu einer franko-afrikanischen Gemeinschaft. Letzteres bedeutete, dass sich die neuen Staaten und Frankreich wechselseitig dazu verpflichten würden, ihr besonderes Verhältnis sowohl militärisch, als auch wirtschaftlich aufrecht zu erhalten. Die RDA entschied sich, ihre Anhänger für ein Ja zur neuen Gemeinschaft zu mobilisieren – mit Ausnahme von Guinea (Conakry) wo die örtliche Sektion der RDA, die PDG, behauptete, sie regiere das Land bereits und habe die Masse der Bevölkerung auf ihrer Seite. Für Guinea wurde deshalb ein Nein empfohlen – auch aus symbolischen Gründen, um ein Beispiel zu setzen, einen Präzedenzfall zu schaffen. Guinea stimmte dementsprechend für die Unabhängigkeit. Frankreich akzeptierte dieses Ergebnis zwar, rächte sich aber, indem es beim Abzug an Ausrüstung alles mitnahm, was sich transportieren ließ. Es war anlässlich dieses Vorfalls, dass Sékou Touré sein berühmtes „Besser Würde im Elend, als Wohlstand in der Unterwerfung!“ sprach (als könnte es im Elend irgendeine Würde geben!). Dass sich alle anderen Sektionen für de Gaulles Vorschlag einer Gemeinschaft aussprachen, hatte nicht nur damit zu tun, dass man die Brüchigkeit der Institutionen, die das nach dem Abzug der Kolonialverwaltung zu erwartende Vakuum hätten füllen sollen, sachlich erkannte. Ein Grund war auch der Wille der RDA-Führung, sich die Möglichkeit offen zu halten, die balkanisierte Region in einem neuen, tragbaren Rahmen wiederzuvereinigen. Nach der Konferenz von Cotonou in Dahomey (dem heutige Benin) hatte sich die „Parti du Regroupement Africain” gebildet, die für eine derartige Wiedervereinigung und einen Föderalismus – das nigerianische Modell – eintrat, etwas, das französische Strategen derart verabscheuten, dass sie noch 1966 die Separatisten in Biafra unterstützten. Politische Spannungen wurden dadurch geschürt, dass man antikommunistische, prowestliche – das heißt anti-RDA – Parteien, Gruppierungen und Einzelpersonen unterstützte. Wo fortschrittliche, charismatische Führer allzu populär wurden, wie im Fall von Felix Moumié von Kameruns UPC, kam es auch dazu, dass der französische Geheimdienst sie kurzerhand ermordete.
Unter großem Druck der jeweiligen Bevölkerungen jedoch wurden bis 1960 alle Mitglieder der Gemeinschaft formal unabhängig. Allerdings gelobten Senegal, Französisch-Sudan (das heutige Mali), Obervolta (das heutige Burkina Faso) und Dahomey (heute Benin) eine Föderation zu bilden. Die beiden letzteren zogen sich jedoch kurzfristig zurück und „Mali“ wurde so zum Namen einer senegalesisch-sudanesischen Föderation. Nachdem sich Senegal, aufgrund französischer Drohungen und Versprechungen, 1961 aus dieser verabschiedete, blieb es der Name des ehemaligen Französisch-Sudan.
Als 1963 die Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) gegründet wurde, bekannte man sich zu einer Reihe von Prinzipien: Der Kontinent solle die Solidarität und Zusammenarbeit in allen Bereichen ständig verbessern; er solle die Befreiungskämpfe in den portugiesischen Kolonien, in Südafrika, Südwestafrika (heute Namibia) und Südrhodesien (heute Simbabwe) aktiv unterstützen; und er solle die aus der Kolonialzeit geerbten Grenzen nicht in Frage stellen, „damit wir nicht die Geburt eines schwarzen Imperialismus erleben“, wie der marxistisch orientierte Präsident Malis, Modibo Keita, in Addis Abeba sagte.
Das jedoch war, auf vielerlei Art, das letzte Mal, das man etwas von den Anführern des Unabhängigkeitskampfes hörte. Ab Mitte der 1960er Jahre kam es, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, in fast allen Ländern Afrikas zu einer Reihe von Militärputschen, die von den ehemaligen Kolonialmächten oder unmittelbar von den USA begünstigt wurden. Die Zivilregierungen verschwanden, und an ihre Stelle traten Despoten und Schlächter, die ihre korrupte Alleinherrschaft über Territorien ausübten, die schwer damit zu kämpfen hatten, sich zu echten Nationalstaaten zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund fand im Juni 1965, am Vorabend der geplanten zweiten afro-asiatischen Konferenz, der Staatsstreich Boumediennes in Algerien statt und brach der bereits erwähnte Biafrakrieg aus. In letzterem unterstützten sogar die Chinesen die USA, Frankreich und Israel beim Kampf gegen die von Großbritannien und der Sowjetunion unterstützte Regierung. Im vormaligen Belgisch-Kongo lief der gesamte Prozess in einem Durchgang ab: Eine gewählte Regierung war kaum im Amt, als der belgisch-amerikanischen Putsch begann. Die Abspaltung Katangas unter Moïse Tshombé, die Ermordung von Patrice Lumumba, der Bürgerkrieg und das militärische Eingreifen der UNO führten zu der jahrzehntelangen Diktatur Mobutus.
Die beiden eng miteinander verbundenen Königreiche Ruanda und Burundi, deutsche Kolonien vor dem 1. Weltkrieg bevor sie belgische Protektorate wurden, müssen in diesem Zusammenhang gesondert erwähnt werden. Die Kolonialherren hatten die Arbeitsteilung zwischen Viehzüchtern und Bauern in diesem sehr alten afrikanischen Nationalstaat als „rassisch“ bedingt verstanden und so künstliche Ethnien erfunden. Sie institutionalisierten demnach die absolute Vorherrschaft der Tutsi-Hirten über die Hutu-Bauern. Dann entdeckte die belgische Niederländisch-reformierte Kirche (die selbe, die die Apartheid in Südafrika segnete) Ende der 1950er Jahre die plebejischen Tugenden der Hutus schlug sich nun ganz auf die Seite der rachedurstigen Hutus und unterstützte diese gegen die vormaligen Tutsi-Herrscher, stellte sich gegen die zunehmend nationalistischen Forderungen des Tutsi-Adels und förderte eine „anti-feudale“ demokratische Revolution, die zu Diskriminierung und Vertreibung und 1959, 1963 und 1972 zu Massakern gegen Tutsis führte. Der Völkermord von 1994, bei dem eine halbe Million Menschen starben, löste schließlich den Sieg und die Rückkehr der Tutsi-Flüchtlinge aus Uganda aus. Die Abwanderung von einer Million Hutu, darunter die reuelosen, bewaffneten Täter des Völkermords, trug die Krise in den benachbarten Kongo (von Mobutu in Zaire umbenannt), wo sie bis heute wesentlich zum anhaltenden inneren Zerfall des Landes beiträgt.
Jeder afrikanische Staatschef und jede Sitzung der Organisation für Afrikanische Einheit, geben zumindest ein Lippenbekenntnis zur Einheit Afrikas ab, aber bewahren Eifersüchteleien zwischen den Mini-Souveränitäten hinter deren Schleier Menschenrechte weiterhin massiv verletzt werden und unter deren Dach sich die Tyrannei weiter ausbreitet. Dass mit Südafrika ein wirtschaftlicher, militärischer und moralischer Riese die Bühne betreten hat, hat daran leider nicht viel geändert. Die Visionen der ersten Generation von Anführern sind heute ferner denn je. Das trifft besonders auf die Schüler und Erben des Pan-Afrikanischen Kongresses zu, der fünf Versammlungen zwischen 1919 und 1945 in Paris, London, Lissabon, Brüssel und New York abhielt, auf Initiative großer Denker wie W.E.B. Du Bois (USA) und George Padmore (Trinidad). Für sie war klar, dass es Afrikanern nur durch Einigkeit gelingen könne, ihr eigenes Schicksal zu meistern. Nach der Unabhängigkeit Ghanas bat Nkrumah Du Bois und seine Lebensgefährtin, die Ballettregisseurin Shirley Graham, ein Großprojekt mit dem Titel „Encyclopedia Africana” zu betreuen. Diese Beziehung zwischen Afrikanern und Afro-Amerikanern ist nicht neu: Von der Rückkehr von Afro-Brasilianern nach Westafrika, Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese das letzte Königreich von Dahomey regierten, (eine echte Rückkehr, nicht zu vergleichen mit der schwarzen Kolonialisierung von Liberia und Sierra Leone), bis hin zu Marcus Garveys Back-to-Africa-Bewegung (die Du Bois heftig bekämpft hatte), über den, zusammen mit Senegals späterem Präsidenten Léopold Sédar Senghor, Miterfinder der Négritude Aimé Césaire aus Martinique bis hin zu seinem Landsmann Frantz Fanon und ihrem Einfluss auf das politische Denken in Afrika, haben sich Afrikaner und die Diaspora in den Amerikas wechselseitig stets stark befruchtet.
Mehr aber noch als dieses geistige Erbe sind es die vieldimensionale Krise, der sich praktisch alle afrikanischen Staaten gegenübersehen und die globalen Herausforderungen, gegen die sie unmöglich allein bestehen können sowie die wachsenden Forderungen der im Entstehen begriffenen Zivilgesellschaften, die möglicherweise, in nicht allzu ferner Zukunft, den kategorischen Imperativ der Einheit in Afrika wieder auf die Agenda des Kontinents setzen werden.
Ilan Halevi ist ein palästinensischer Schriftsteller und Politiker. Er hat seit den frühen 1960er Jahren in zahlreichen Teilen Afrikas gearbeitet und hat weite Teile des Kontinents bereist. Aktuell lebt er in Berlin.